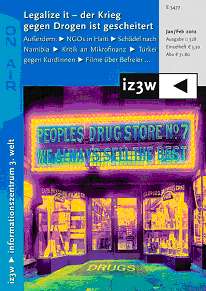Entwicklungspolitik
»In Menschen investieren« – mit diesen Worten fordert die
Genossenschaft Oikocredit AnlegerInnen auf, ihr Geld zugunsten
von Mikrokrediten »ethisch« anzulegen. Mit diesen
Kleinstkrediten sollen Einzelpersonen in Entwicklungsländern
befähigt werden, unternehmerisch tätig zu werden. Die
entwicklungspolitische Szene feierte Mikrokredite als
Erfolgsmodell zum Empowerment der Armen. Längst sind nicht mehr
nur NGOs und Entwicklungsagenturen in der Mikrofinanz tätig,
sondern auch Banken wie die Deutsche Bank und die GLS-Bank.
Einer der bislang wenigen KritikerInnen der Mikrofinanzindustrie
im deutschsprachigen Raum ist der Journalist Gerhard Klas. Er
veröffentlichte im Oktober 2011 das Buch »Die
Mikrofinanz-Industrie. Die große Illusion oder das Geschäft mit
der Armut« (siehe Rezension in iz3w 327). Anlässlich seiner
Buchpräsentation in Freiburg fragten wir nach den Gründen für
seine Kritik.
Entwicklungspolitik: »Schmutziges Wasser für Verdurstende« .
Interview mit Gerhard Klas über seine Kritik an Mikrokrediten
iz3w: Was war für Sie der entscheidende Moment, der
Mikrofinanzindustrie auf den Grund zu gehen?
Gerhard Klas: Als Muhammad Yunus, der Gründer der Grameen Bank,
2006 den Friedensnobelpreis erhielt, da jubelte eine
interessante Allianz von Bankvorständen, Großkonzernen,
AgentInnen der Entwicklungspolitik bis hin zu NGOs. Im Jahr
darauf erfuhr ich von einer Frauenorganisation im indischen
Bundesstaat Andhra Pradesh, dass sich dort ein halbes Jahr zuvor
eine soziale Krise der Überschuldung ereignet hatte, als Folge
der Mikrokredite. Das wurde damals aber nur in der indischen
Öffentlichkeit thematisiert. Es gab mehrere Selbstmordfälle,
dennoch stand die Nobelpreisverleihung an Yunus nicht in einem
schlechten Licht. Gleichzeitig erlebte die Mikrofinanzindustrie
gerade in Indien einen neuen Boom.
Anfang 2010 reiste ich nach Bangladesch, in die Wiege der
Mikrofinanz, wo mit rund 30 Millionen Menschen ein Fünftel vor
allem der weiblichen Bevölkerung bei einem oder mehr
Mikrofinanzinstituten (MFI) verschuldet ist. Hier habe ich mit
Frauen- und Kleinbauernorganisationen, kritischen ÖkonomInnen,
der Direktorin der staatlichen Aufsichtsbehörde und ehemaligen
MitarbeiterInnen der Grameen Bank über Mikrokredite gesprochen.
Das Ergebnis war ernüchternd. Ein Radiofeature, das nach dieser
Recherchereise entstanden war, löste viel positive und negative
Resonanz aus. Anhänger der Mikrofinanz kritisierten den Beitrag,
von Oikocredit bis hin zu ehemaligen Staatssekretären des BMZ.
PrivatanlegerInnen, die ihr Geld Mikrofinanzprojekten zur
Verfügung gestellt hatten, waren verunsichert. So entschloss ich
mich, ein Buch über den Widerspruch zwischen der behaupteten
Armutsbekämpfung und der tatsächlichen Überschuldung vieler
Frauen durch die Mikrofinanz zu schreiben.
Wie sehen die Realitäten in Bangladesch aus?
Die behaupteten Segnungen gründen hauptsächlich auf der hohen
Rückzahlquote, die als Beleg auch für die soziale Wirksamkeit
der Mikrokredite angeführt wird. Eine Frage wird dabei
ausgeklammert: Wie sind die SchuldnerInnen in der Lage, Kredite
zu 20 Prozent Jahreszins und mehr zurückzuzahlen? Welche
Konsequenzen hat das für sie und ihre Familien? In Bangladesch
und in Andhra Pradesh gibt es mehr MFI als sonst irgendwo, es
herrscht große Konkurrenz. Hier gehen viele Frauen, die eine
Rate nicht mehr zahlen können, zum nächsten Anbieter und
erhalten einen neuen Kredit. In Bangladesch sind siebzig Prozent
der Frauen bei mehreren MFI verschuldet.
Sind das privatwirtschaftliche Anbieter oder öffentliche
Institutionen?
Viele MFI haben sich anfangs mit den Geldern von
institutionellen oder nichtkommerziellen Investoren finanziert,
z.B. der Weltbank und Oikocredit. Später, als diese MFI dann den
von den Investoren geforderten Beweis der finanziellen
Nachhaltigkeit erbracht hatten, sind kommerzielle Investoren
eingestiegen. Letztere wollen vor allem für ihre AnlegerInnen
eine gute Rendite erwirtschaften. Grundlage dafür ist, dass die
MFI ohne Zuschüsse und Subventionen einen Profit erwirtschaften
können. Das entspricht dem Leitmotto der Weltbank, die
Privatwirtschaft könne auch mit den Ressourcen der Armen Gewinne
erzielen. Es gibt zahlreiche Fonds zur Finanzierung von
Mikrofinanzinstitutionen, die vor allem in Luxemburg und der
Schweiz notiert sind. An den Fonds sind zum Beispiel die
Deutsche Bank, Credit Suisse, BNP Paribas, die ehemalige
britische Kolonialbank Standard-Chartered, aber auch die
katholische Pax-Bank beteiligt.
Wie kommen die hohen Zinssätze zustande?
In Südasien müssen MFI zirka zwölf Prozent Zinsen zahlen, wenn
sie sich Kapital bei kommerziellen Banken beschaffen – oder sie
bedienen sich auf den internationalen Finanzmärkten und müssen
die bisweilen zweistelligen Renditeerwartungen der Anleger
erfüllen. Zinsen und Profite müssen ebenso wie die Inflation von
derzeit mehr als acht Prozent irgendwie erwirtschaftet werden.
Und die MFI haben relativ hohe Kosten, weil viele kleinteilige
Kredite einen höheren administrativen Aufwand darstellen als ein
großer Kredit. Aus Perspektive der MFI ist ein Zinssatz von 20
Prozent gerade kostendeckend, meist liegen die Zinsen für die
EndkreditnehmerIn weit darüber. Für sie sind diese hohen Zinsen
eine Belastung. So viel Geld kann nur in Ausnahmen und in
wenigen Sektoren erwirtschaftet werden, z.B. im Einzelhandel.
Oder von Frauen, die das Geld zu noch höheren Zinsen weiter
verleihen – was zunehmend der Fall ist.
Sie sprechen mit größter Selbstverständlichkeit von »Frauen« –
sind sie die bevorzugte Zielgruppe der MFI?
Es gibt sehr unterschiedliche Modelle, das dominante Modell ist
nach wie vor das der Grameen Bank. Sie verleiht vor allem Geld
an Frauengruppen beziehungsweise an einzelne Frauen, die ihre
Kreditwürdigkeit durch die Mitgliedschaft in der Gruppe beweisen
müssen. Sowohl die Frauenrechtlerin Farida Akther, aber auch
SoziologInnen und AnthropologInnen sagen, es gehe nicht um die
so gerne betonte Emanzipation der Frauen. Kredite würden
bevorzugt an Frauen vergeben, weil sie sich viel stärker für die
Familie verantwortlich fühlten, sie weniger mobil seien und
dafür besser greifbar, um die Raten einzutreiben.
Die nordamerikanische Anthropologin Lamia Karim sagt, die
Mikrofinanz sei eine »Ökonomie der Beschämung«. Die Frauen
wachsen im Dorf auf, das ist ihr sozialer Referenzrahmen. Würde
spielt hier eine ungeheuer wichtige Rolle. Die Frauen, die nicht
zurückzahlen können, werden von den Mitarbeitern der MFI – in
Südasien fast ausschließlich Männern – beleidigt und beschämt,
zum Teil aber auch von anderen Frauen, mit denen sie in einer so
genannten Selbsthilfegruppe organisiert sind. Und das erzeugt
den viel zitierten »sozialen Druck«, die Raten zurückzuzahlen.
So fährt z.B. die ganze Belegschaft einer Grameen Bank Filiale
mit ihren Zweirädern vor die Häuser säumiger Schuldnerinnen und
belagert sie, bis die Rate gezahlt ist. In Indien wurden Frauen
gar zur Prostitution aufgefordert, um Raten zurückzuzahlen.
Wie kommt es zu der oft angeführten Schuldenspirale durch
Mikrokredite?
Alle Modelle der MFI gehen davon aus, dass die Lebensumstände
und Marktbedingungen immer gleich bleiben. Krankheiten,
Katastrophen, Wirtschaftskrisen oder Unfälle werden nicht
einkalkuliert. Sobald nur einer dieser Fälle eintritt, gerät das
gesamte System ins Wanken. Wenn z.B. jemand erkrankt, liegen die
Prioritäten des Familienhaushaltes bei der Behandlung. Oft
bleibt dann kein Geld übrig. Hier fängt die Spirale an: Irgendwo
müssen die KreditnehmerInnen Geld für die Raten auftreiben. Sie
fragen Nachbarn, die Familie oder Freunde. Dazu werden sie von
den MitarbeiterInnen der MFI regelrecht angehalten. Irgendwann
sind auch diese Geldquellen erschöpft. Der nächste Schritt ist
der Gang zu einer weiteren MFI. Der übernächste Schritt, der
auch den Verlautbarungen von Yunus widerspricht, ist der Gang zu
den lokalen Geldverleihern. Sie nehmen Zinsen von bis zu 100
Prozent. Später schicken die Frauen ihre Kinder zur Arbeit statt
zur Schule, verpachten oder verkaufen kleinere Ländereien, den
Haushalt oder gar ihr Haus.
In der entwicklungspolitischen Debatte ist ein Argument für die
Vergabe von Mikrokrediten die Stärkung der Schwächsten und die
Ermächtigung von Frauen. Ihre Berichte widersprechen dem.
Die Mikrofinanz schwächt das Prinzip der gegenseitigen Hilfe und
Solidarität, das innerhalb der Kasten und Klassen in vielen
Dörfern das Leben prägte. Heute hat eine Frau, die Mitglied in
einer Gruppe ist, nicht selten Angst davor, dass die anderen von
der Krankheit eines Familienmitgliedes erfahren, weil sie
vielleicht die nächste Rate nicht zurückzahlen kann – und dann
würde die ganze Gruppe als »kreditunwürdig« eingestuft und von
den Geldeintreibern der MFI unter Druck gesetzt.
Ist das von der Mikrofinanz propagierte Bild der armen
Kleinbäuerin, die zur erfolgreichen Unternehmerin wird, reine
Propaganda?
Nehmen wir an, die Kreditnehmerin pachtet von ihrem Kredit in
Höhe von vielleicht 40 bis 100 Euro ein Stück Land, um
Nahrungsmittel anzubauen und diese auf dem Markt zu verkaufen.
Es dauert mindestens drei Monate, bis sie eine Ernte verkaufen
kann. Die Ratenzahlungen beginnen in der Regel eine Woche nach
Aufnahme des Kredits. Eine sofortige Rückzahlung der Raten ist
illusorisch, die meisten sind hierzu nicht in der Lage. Für die
Landwirtschaft ist dieses dominante Modell der Grameen Bank
ungeeignet.
Gibt es auch Erfolge der Mikrofinanz?
Einzelbeispiele, die den vermeintlichen Erfolg beweisen sollen,
werden in Hochglanzbroschüren vervielfältigt. Doch die sind
nicht repräsentativ. Anu Muhammad, wie Muhammad Yunus ein Ökonom
aus Bangladesch, spricht von fünf bis zehn Prozent, die mit
Hilfe von Minikrediten den Sprung aus der Armut schaffen. Bei
weiteren 40 stagniert die Situation, die restlichen 50 Prozent
stürzen noch tiefer in die Armut.
Wer dank Mikrokredit ein Kleinunternehmen gründet wie etwa eine
Schneiderei, braucht entsprechende Nachfrage. Wie sinnvoll ist
diese Inflation der Ich-AGs?
Der Vergabe von Mikrokrediten geht in der Regel keine
Situationsanalyse der dörflichen Strukturen voraus.
Möglicherweise wird die zehnte Nähmaschine in einem Dorf mit
tausend EinwohnerInnen finanziert. Auch die Frage der
Verdrängung von älteren Betrieben durch MFI-Projekte ist bisher
nicht untersucht worden. Man kann deshalb nicht voraussetzen,
dass Mikrofinanz die wirtschaftliche Entwicklung lokaler
Strukturen unterstützt.
Wie ist die große Nachfrage nach Mikrokrediten angesichts der
inzwischen durchaus bekannten Leidensgeschichten zu erklären?
Welche Rolle spielen NGOs?
In Bangladesch gibt es kaum noch NGOs, die nicht auch
Mikrokredite vergeben. Es sind weit über tausend. Achtzig
Prozent des Marktes werden jedoch von den drei großen Banken
abgedeckt, der Grameen Bank, BRAC und ASA. Letztere fingen als
NGOs an, gefördert mit entwicklungspolitischen Geldern aus dem
Westen. Die Nachfrage nach Mikrokrediten hängt indirekt mit den
Strukturanpassungsprogrammen (SAP) der 1980er und 1990er Jahre
zusammen. Mit den SAPs sollte der Staatshaushalt eingedampft
werden, dafür wurden öffentliche Einrichtungen der
Daseinsvorsorge etwa im Bildungs- und Gesundheitssektor
privatisiert oder mit hohen Gebühren belegt. Die Menschen
brauchen also Geld, wenn sie diese Leistungen in Anspruch nehmen
wollen.
Zweitens haben die industrielle Landwirtschaft und die
Marktöffnung für Agrarimporte viele Bauern und Bäuerinnen in die
Knie gezwungen. Vor allem verschuldete Bauern haben ihrerseits
die Subsistenzwirtschaft zugunsten des Anbaus von
monokulturellen Cashcrops für den Export aufgegeben. Die
Preisvolatilität ist jedoch hoch, und die Landwirte können das
Geld, das sie zum Überleben brauchen, nicht mehr erwirtschaften.
Ihr Bedarf an Bargeld, um die lebensnotwendigen Grundlagen zu
finanzieren, ist also enorm gewachsen, bedenkt man, dass die
Armen zwischen 60 und 80 Prozent ihres Geldes allein für
Lebensmittel ausgeben müssen, wenn sie nicht auf irgendeine Art
von Teilsubsistenz zurückgreifen können. Der Mikrofinanzexperte
Malcolm Harper, einer der wenigen Kritiker, der selber in der
Branche tätig ist, sagte: »Es ist, als würde man schmutziges
Wasser an Verdurstende verkaufen«.
Zudem sind Mikrokredite integraler Bestandteil der
Monetarisierung und Privatisierung vormals öffentlicher
Dienstleistungen. Diese gewollte Entwicklung hat in der Fachwelt
den euphemistischen Namen »Financial Inclusion«. Problematisiert
wird die Tatsache, dass Arme keinen Zugang zu Bankkonten haben.
Ziel ist, diese Leute in den Finanzmarkt und in den globalen
Geldfluss zu integrieren. So werden Gesellschaftsstrukturen, die
teils auf Tausch und Subsistenz beruhen, marktwirtschaftlich
durchdrungen, auch um Absatzmärkte für westliche Konzerne zu
schaffen. Ein Beispiel ist Grameen Phone, das inzwischen
umsatzstärkste Telefonunternehmen in Bangladesch, das für den
norwegischen Telekommunikationskonzern Telenor Profite
erwirtschaftet. Die so genannten ‚Grameenfrauen’ haben sich mit
Hilfe von Mikrokrediten Handys von Nokia beschafft, um dann
Telefoneinheiten an Frauen im Dorf weiter zu verkaufen. Heute,
nach nur wenigen Jahren, gibt es kaum noch ‚Grameen-Ladies’,
weil immer mehr Menschen in Bangladesch selbst ein Handy
besitzen. Die Mikrofinanz schafft Absatzmärkte, von denen große
westliche Konzerne profitieren.
Das klingt ein wenig nach Masterplan – als seien Mikrokredite
ein instrumentelles Werkzeug, um die Interessen des Nordens zu
befriedigen. Das Konzept kommt aber aus Bangladesch, und Yunus
vertritt nicht die Interessen der Deutschen Bank.
Das stimmt. Doch der mögliche Profit ist eine Motivation, warum
an der Mikrofinanz festgehalten wird, obwohl ihre Erfolge bei
der so genannten Armutsbekämpfung nicht nachweisbar sind. Selbst
viele Apologeten müssen dies eingestehen. Es gibt auch eine
ideologische Komponente: Der Kapitalismus ist in den 1990er
Jahren global geworden. Da war ein Konzept willkommen, das unter
Beweis stellen sollte, dass auch die Armen vom Kapitalismus
profitieren können. Tatsächlich verdeckt die Mikrofinanz mit
ihrem Ansatz die strukturellen Ursachen der Armut. Es wird so
getan, als ob jeder der Armut entfliehen kann, wenn er oder sie
sich nur auf die Spielregeln der Marktwirtschaft einlässt.
Gibt es konkrete Alternativen zur Mikrofinanz?
Wenn man diese Geldquellen einfach wegnimmt, ist den Armen unter
den jetzigen Bedingungen nicht geholfen. Sie brauchen Geld für
medizinische Versorgung, Bildung und Lebensmittel. Nach der
Krise in Indien gibt es jetzt den Vorschlag, mit
Mikroversicherungen, Sparkrediten und Kreditinformationsbüros
das Problem der Verschuldung zu lösen. Miniversicherungen und
Sparprogramme verursachen für die Schuldnerin jedoch zusätzliche
Kosten, wenn etwa wöchentlich ein Spargroschen oder Beiträge zu
entrichten sind, die im Fall der Rückzahlungsunfähigkeit als
Sicherheit verwendet werden. Kreditinformationsbüros sind
problematisch, denn sie sollen die Kreditwürdigkeit beurteilen.
Überschuldung ist jedoch ein wesentliches Merkmal der Verarmung.
Es würden dann ausgerechnet die Ärmsten ausgeschlossen, denen
doch mit der Mikrofinanz geholfen werden sollte.
Ein Kreditinformationsbüro ist also kein Verbraucherschutz,
sondern vergleichbar mit der Schufa?
Genau. Die Kreditinformationsbüros dienen der Risikoabsicherung
der MFI, sie arbeiten nicht im Sinne der Kreditnehmerinnen.
Geeigneter wären Zinsobergrenzen oder auch Direktsubventionen
für die Kreditnehmerinnen statt günstige Anschubfinanzierungen
für die MFIs. Weltbank und die Kreditanstalt für Wiederaufbau
lehnen das als Wettbewerbsverzerrung einhellig ab und sagen, das
widerspreche dem Konzept des nachhaltigen Wirtschaftens.
Unmittelbare staatliche Regulierungen sind höchstens eine kurz-
bis mittelfristige Strategie, um die schlimmsten Auswirkungen
der Mikrofinanz abzudämpfen. Erst wenn man das Wort »Kredit«
durch »Schulden« ersetzt, nimmt man tatsächlich die Perspektive
der SchuldnerInnen ein. Dann wird die Absurdität des Ganzen
deutlich. Wie soll man sich mit Schulden und hohen Zinssätzen
selbst aus Armut befreien? Seriöse Alternativen hingegen
beinhalten immer ein Element der Umverteilung des akkumulierten
Reichtums an die Armen.
Manche KritikerInnen betrachten die Mikrofinanz als modernes
Modell der Kolonialisierung. Romantisieren sie nicht das Lokale,
die Subsistenz und die traditionellen sozialen Beziehungen und
zeichnen dabei ein Zerrbild des internationalen Finanzkapitals?
Profiteure der MFI, die sich auf Kosten der Armen bereichern,
gibt es überall. Das zeigt das Beispiel der Grameen Bank. Wenn
die Mittel- und Oberschicht in Bangladesch ihr Geld hier
investiert, erhält sie dafür Zinsgewinne. In Indien haben
Vorstände mancher MFI wie SHARE Microfin, die einst von
Oikocredit gefördert wurden, mehr Geld verdient als die
Vorstandsvorsitzenden kommerzieller Banken. Der Konflikt ist
nicht nur einer des Westens gegen den Globalen Süden.
Läuft die Kritik an den MFI nicht Gefahr, nur den Zins oder das
Geld zu kritisieren – und damit die globalen kapitalistischen
Verhältnisse außer Acht zu lassen?
Bei meiner Kritik geht es um die Ausbeutung der Ressourcen der
Armen mittels der Mikrofinanz. Dazu gehört auch die ‚Ware’
Arbeit, die sie verkaufen müssen. Yunus behauptet, jede/r sei
sein/e eigene/r UnternehmerIn. Statt die in wenigen Ländern hart
erkämpften Errungenschaften und Schutzmechanismen der
lohnabhängigen Bevölkerung im Kapitalismus auszubauen,
verhindern Mikrokredite gewerkschaftliche Organisierung und die
Einführung von Arbeitszeitbegrenzung, Urlaub oder sozialer
Absicherung. Das mit der Mikrofinanz beförderte ‚freie
Unternehmertum’ bedeutet grenzenlosen Zugriff auf die
Arbeitskraft der SchuldnerIn und die ihrer Angehörigen, also
eine Maximierung der Ausbeutung. Insofern würde ich eher von
verlängerter und nicht von verkürzter Kapitalismuskritik
sprechen.
Das Interview führten Martina Backes, Gerald Wittle und
Christian Stock.
|
iz3w – Verlag und Redaktion |
Tel: 0049-(0)761-74003 Fax: -709866 |
|
Postfach 5328 |
E-mail:
info@iz3w.org |
|
D-79020 Freiburg |
Internet:
www.iz3w.org |
|