Die Grippe
bekämpfen, indem man nach mehr Viren verlangt?
Anmerkungen zum gewerkschaftlichen K(r)ampf gegen
Arbeitslosigkeit
Es gibt 2
Phänomene kapitalistischer Entwicklung, die die Verschlechterung
der sozialen Lage von LohnarbeiterInnen in den kapitalistischen
Zentren besonders kennzeichnen und die die Polarisierung
zwischen den Hauptklassen dieser Gesellschaft und den
Klassenkampf prägen und an Bedeutung noch gewinnen werden:
1.
die „Pleitenflut“
2.
die Verlagerung von Produktionsstätten in sog. Billiglohnländer
Neben den
zyklisch wiederkehrenden Krisen und der „Wegrationalisierung“
von Lohnarbeitsplätzen (Erhöhung von Arbeitsproduktivität durch
Einsatz von Technik, Intensivierung der Arbeit durch
Reorganisation) bestimmen diese beiden Faktoren die Entwicklung
der Lohnarbeitslosigkeit. Existenzielle Unsicherheit und
drohende, sowie tatsächliche Verarmung erfassen immer größere
Teile der Lohnabhängigen.
Kämpfe gegen
Massenentlassungen und Betriebsschließungen haben in den letzten
Jahren bereits Schlagzeilen gemacht und diese Kämpfe werden in
den nächsten Jahrzehnten (man sollte nicht vergessen, dass ein
Zyklus im Schnitt immer noch rund 10 Jahre dauert!) an Bedeutung
zunehmen.
Kommt es zu sozialen Auseinandersetzungen, so werden diese mit
einem kaum entwickelten Klassenbewusstsein geführt. Das drückt
sich darin aus, dass jeder für sich allein stirbt. Die Kämpfe
werden fast ausschließlich als Abwehrkampf der jeweils
betroffenen Belegschaft geführt.
Die lohnabhängigen Individuen denken und handeln mehrheitlich
bürgerlich. Die eigene soziale Lage wird als individuelles
Schicksal empfunden und individuell bearbeitet. Die
lohnabhängigen „MitarbeiterInnen“ in den Betrieben entwickeln
allenfalls ein Kollektivbewusstsein auf der Ebene „ihres“
Betriebes, als „Belegschaft“, nicht als Teil der Klasse. Dieser
Mangel an Klassenbewusstsein, dessen Ursachen ich hier nicht
näher beleuchten will (er ist jedenfalls nicht ausschließlich,
nicht einmal vorrangig auf Gewerkschaftspolitik zurück zu
führen), macht es der offiziellen Gewerkschaftspolitik leicht,
dass Feld zu beherrschen und wichtige Lernprozesse zu
verhindern. Diese Lernprozesse und eine möglicher Weise daraus
folgende Verbreiterung der Bewegung, der Solidarisierung und
zunehmenden Organisierung wird unmöglich gemacht durch die
Zuspitzung der Kritik auf das jeweilige Management bzw. die
Geschäftsführung des Betriebes. Die offizielle
Gewerkschaftspolitik unterstellt die Möglichkeit eines
grenzenlos wachsenden Kapitals, dessen Nachfrage nach
menschlicher Arbeitskraft immer groß genug sein könne, um
„Vollbeschäftigung“ zu sozial erträglichen Bedingungen zu
garantieren. Auf gesamtgesellschaftlicher Ebene sei dies durch
eine entsprechende nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik zu
gewährleisten, auf der einzelbetrieblichen Ebene könne dies
gewährleistet werden durch eine kluges Management, dass immer
für genug Aufträge sorgt. Bravo!
Diese
teilweise geradezu dümmliche Desorientierung hat immer noch
großen Erfolg. Sie verhindert Erkenntnisse über Zusammenhänge
kapitalistischer Reproduktion und damit Erkenntnisse über
bestehende Klassengegensätze. Alle Kritik bleibt moralisierende
Detailkritik die letztlich hinausläuft auf ein Beklagen von
Raffgier und Unfähigkeit des Managements oder der Politik. Die
meisten Kämpfe werden so mit unglaublichen Illusionen und /oder
ohnmächtiger Perspektivlosigkeit im Kopf geführt.
Man erklärt von Gewerkschaftsseite den Kampf gegen die
Lohnarbeitslosigkeit zur Hauptaufgabe, um ihn dann als Kampf um
Lohnarbeitsplätze zu einer Farce zu machen. Wer den Kampf gegen
Lohnarbeitslosigkeit – nämlich deren verheerende soziale Folgen
- ernst meint, der muss ihn als Kampf gegen das Lohnsystem
führen. Dass das so ist, liegt an den Ursachen der
Lohnarbeitslosigkeit, jenen grundlegenden
Produktionsverhältnissen, die gesetzmäßig die
Lohnarbeitslosigkeit produzieren. Womit ich wieder beim
Ausgangspunkt wäre, etwa den beiden Faktoren „Pleitenflut“ und
Verlagerung der Produktion in Billiglohnparadiese des Kapitals.
Ich habe diese beiden Faktoren besonders erwähnt, nicht nur
wegen ihrer ins Auge springenden Bedeutung, sondern auch
deshalb, weil sich an ihnen ein paar wichtige theoretische
Zusammenhänge illustrieren lassen und weil diese oft auch auf
Seiten der Linken arg unterbelichtet sind. Wer in solche
konkreten Auseinandersetzungen intervenieren und die
Gewerkschaftspolitik kritisieren will, der sollte theoretisch
gut gerüstet sein. Die Erfolge von Phraseologie sind begrenzt
und führen niemals zum Erfolg, der sich nur durch
kontinuierliche und langfristig angelegte Arbeit einstellen
kann.
Beides,
Verlagerung der Produktion ins Ausland, wie auch die Pleitenflut
sind Produkt sinkender Kapitalrentabilität und zugleich
Gegenbewegung gegen den Fall der Profitrate des Kapitals.
Verlagerung von
Produktion in Billiglohnländer
Auch die „Raffgier“-Spezialisten,
die Lohnarbeitslosigkeit allein als Folge subjektiver
Fehlentscheidung von Politik und Management begreifen, wissen
und argumentieren natürlich mit der höheren Profitrate, die in
den Billiglohnländern winkt. Was sie gern weglassen, ist der
Umstand, dass auch schon vor dem angeblichen unentrinnbaren
Schicksalsschlag der sog. „Globalisierung“ viele
Billiglohnländer existierten, ohne das deshalb ein Exodus der
kapitalistischen Industrie begann. Der Exodus etwa der
Textilindustrie (das war sozusagen die Avantgarde) begann erst
da, als die so sehnlich zurück gesehnte Zeit „allgemeiner
Wohlfahrt“ in den hochentwickelten Ländern durch erste Krisen
erschüttert wurde. Der Exodus wurde in dem Maße attraktiver, wie
in den Zentren der Kapitalakkumulation die Renditen sanken und
die „Pleitenflut“ einsetzte. Der Kollaps des Realsozialismus war
nicht die Ursache des Exodus, sondern ein gewünschter
zusätzlicher und begünstigender Umstand, der dem produktiven
Kapital Flügel verlieh. Die Verlagerung von Produktionsstätten
in Billiglohnländer ist Produkt ungenügender Kapitalrentabilität
in den hochentwickelten Ländern, die sich ebenfalls zwingend
ausdrückt in der „Pleitenflut“.
„Pleitenflut“
Sinkende Profitrate drückt
nichts anderes aus als relative Abnahme der Mehrwertmasse
gegenüber dem gesamten angelegten Kapital (variables und
konstantes Kapital). Um eine gleichgroße Mehrwertmasse zu
erzielen, wird ein stets wachsender Kapitalvorschuss
erforderlich. Wächst das Kapital nicht in genügend großer
Progression, um den Fall der Profitrate zu kompensieren, dann
entbrennt der Kampf um relativ abnehmende Mehrwertmasse, es
entwickelt sich der sogenannte „Verdrängungswettbewerb“ als
Gegenbewegung.
|
„Solange alles gut geht,
agiert die Konkurrenz, wie sich bei der Ausgleichung der
allgemeinen Profitrate gezeigt, als praktische
Brüderschaft der Kapitalistenklasse, so daß sie sich
gemeinschaftlich, im Verhältnis zur Größe des von jedem
eingesetzten Loses, in die gemeinschaftliche Beute teilt.
Sobald es sich aber nicht mehr um Teilung des Profits
handelt, sondern um Teilung des Verlustes, sucht jeder
soviel wie möglich sein Quantum an demselben zu verringern
und dem andern auf den Hals zu schieben. Der Verlust ist
unvermeidlich für die Klasse. Wieviel aber jeder einzelne
davon zu tragen, wieweit er überhaupt daran teilzunehmen
hat, wird dann Frage der Macht und der List, und die
Konkurrenz verwandelt sich dann in einen Kampf der
feindlichen Brüder. Der Gegensatz zwischen dem Interesse
jedes einzelnen Kapitalisten und dem der
Kapitalistenklasse macht sich dann geltend, ebenso wie
vorher die Identität dieser Interessen sich durch die
Konkurrenz praktisch durchsetzte.“ Kapital Bd. 3
|
Gegenbewegung deshalb, weil die Zahl der selbständigen
Kapitale sich verringert und die relativ abnehmende
Mehrwertmasse auf weniger Kapitale verteilt werden kann, also
eine größere Mehrwertmasse pro Einzelkapital zur Verfügung
steht.
Marx sagt: „So wirkt das Gesetz (des Falls der Profitrate,
R. S.) nur als Tendenz, dessen Wirkung nur unter bestimmten
Umständen und im Verlauf langer Perioden schlagend hervortritt.“
(Kapital Bd. 3 Seite 249)
Die
„Pleitenflut“ ist eine der „schlagendsten“ Auswirkungen des
Falls der Profitrate. Sie ist sehr einfach empirisch zu
erfassen, ganz ohne Bruchrechnen und ohne Überlegungen, was und
wie zu berechnen ist. Jenseits aller Berechnungsschwierigkeiten
zeigt sich in der „Pleitenflut“ ein relativer Mehrwertmangel des
gesellschaftlichen Gesamtkapitals. Diese „Pleitenflut“
entwickelt sich ähnlich, wie die Lohnarbeitslosigkeit. Sie
entwickelt sich schubweise mit jedem „Konjunktureinbruch“, ohne
dass in den Aufschwungphasen die Zahlen der
Unternehmenszusammenbrüche auf ein „normales“ Maß zurückgeführt
werden könnte. Die Anzahl der Unternehmenszusammenbrüche
konsolidiert sich vielmehr auf einem stets höheren Niveau,
ähnlich wie die Zahl der außer Kurs gesetzten Lohnabhängigen.
|
Sinkende
Unternehmensinsolvenzen werden derzeit gemeldet. Doch eine
Untersuchung von Euler Hermes kommt zu ganz anderen
Ergebnissen.
Nach einer Schätzung von Deutschlands
führendem Kreditversicherer (Allianz Gruppe) wird der viel
gefeierte Rückgang der Pleiten in den letzten zwölf
Monaten bereits im neuen Jahr wieder zum Stillstand
kommen, die Zahl der Unternehmenszusammenbrüche sogar
ansteigen, und zwar um 3,6 Prozent auf 40.000. Das wäre
ein neuer Negativrekord !
Besorgniserregend ist die steigende Insolvenzquote
Interessanter als absolute
sind auch hier relative Insolvenzzahlen. So liegt die
„Insolvenzquote“, also das Verhältnis zwischen insolventen
Firmen und bestehenden Unternehmen, derzeit bei 1,3
Prozent, bzw. bei 130 Pleiten je 10.000 Unternehmen. Für
2006 rechnet Euler Hermes sogar mit 137, die Quote
erreicht dann fast 1,4 Prozent. Anfang der siebziger Jahre
betrug sie dagegen nur 0,2 Prozent.
Die
Insolvenzquote ist somit in den zurückliegenden
Jahrzehnten „schubartig“ gestiegen, und zwar jeweils im
Gefolge der drei Rezessionen in den siebziger, achtziger
und neunziger Jahren sowie der Wachstumsschwäche seit
Beginn dieses Jahrzehnts. Allerdings bildete sich die
Quote in den konjunkturell guten Jahren nicht genügend
zurück, so dass jeweils die nächste Rezession von einem
höheren Sockel aus begann. Eine wirkliche Erholung fand
nur während der langjährigen Aufschwungphase in der
zweiten Hälfte der achtziger Jahre statt.
Trauriges
Fazit der Kreditversicherer: „Langfristig nimmt die
Insolvenzquote zu.“
Und immer
mehr gute Firmen gehen pleite
Besorgniserregend ist zudem, dass immer mehr eigentlich
gut aufgestellte („markterfahrene“) Unternehmen vom
Pleitestrudel erfasst werden. So stieg deren Anteil von 20
Prozent Anfang der neunziger Jahre auf aktuell 30 Prozent,
ein deutliches Indiz für die Verfestigung der
Insolvenzanfälligkeit innerhalb der letzten zehn Jahren.
Quelle:
Das Ende der Pleitewelle ? Insolvenzprognose 2006 für Deutschland und die
Industrieländer, Wirtschaft Konkret, Nr. 411,
Euler Hermes Kreditversicherung (Allianz Gruppe)
|
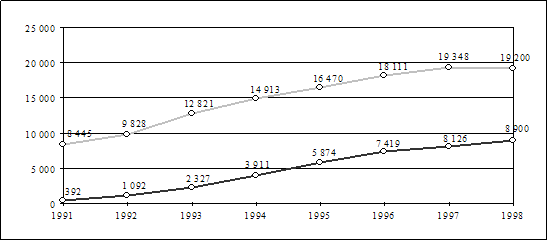
Darin drückt
sich deutlich ein Versagen des kapitalistischen Privateigentums
aus, das Versagen des Kapitalverhältnisses! Beide Seiten
verlieren die Kapitalproduktion als ihre Lebensgrundlage: jene,
die über die Produktionsmittel verfügen und jene, die vom
Verkauf ihrer Arbeitskraft leben müssen. Dieses Versagen des
Privateigentums wird sehr ungern zur Kenntnis genommen von all
jenen, die sowieso ein Interesse an der Aufrechterhaltung des
Kapitalverhältnisses haben, aber auch von jenen, die keinerlei
ökonomische Schranken für die Entwicklungsmöglichkeiten des
Kapitals sehen können und den Menschen die Überwindung der
Lohnarbeitslosigkeit auf der Basis kapitalistischer
Produktionsverhältnisse versprechen.
Wir befinden
uns in der Boomphase des aktuellen Zyklus, die für das Kapital
diesmal erfreulicher ausfällt, als in den vorangegangenen
Zyklen. Darin drückt sich nichts anderes aus, als gewisse
Erfolge des Kapitals, wie der neoliberalen politischen Reaktion,
bei der Herstellung von profitableren Verwertungsbedingungen
(mehr Arbeit für das Kapital und weniger für die eigene
Reproduktion durch Verlängerung der Arbeitszeit, Drücken von
Löhnen, Sozialraub in all seinen Varianten). Dieser Boom wird im
Katzenjammer enden, wie jeder Boom zuvor, aller Sprüche über den
wieder gefundenen „Wachstumspfad“ zum Trotz. Mehr noch dieser
Boom bereitet einen neuen Investitionszyklus vor, der wiederum
zur Neuanlage von Kapital führt, das relativ weniger
Lohnarbeitskraft nachfragt und damit den relativen
Mehrwertmangel weiter verschärft. „Insolvenzquote“ und die Quote
der Lohnarbeitslosigkeit werden langfristig-überzyklisch immer
weiter steigen.
Welche realistische Perspektive haben also betriebliche Kämpfe gegen
Massenentlassungen, Betriebsverlagerungen und
Unternehmenszusammenbrüche?
Weil die wachsende
technische und - daraus folgend - die Wert-Zusammensetzung des
Kapitals notwendig zur relativen Abnahme der Mehrwertmasse und
damit zum „Kampf der feindlichen“ Brüder um die
Verlustzuweisungen (Kapitalvernichtung) führt, ist der
gewerkschaftliche Kampf „um jeden Arbeitsplatz“ ein
aussichtsloses Unterfangen, dass sich an den ökonomischen
Gesetzen bricht. Die Kämpfe aus Anlass von Betriebsverlagerungen
und Pleiten, werden aber auf jeden Fall immer mehr das Gesicht
der Klassenkämpfe bestimmen, weil diese Kämpfe das
unvermeidliche Produkt der ökonomischen Gesetze sind.
Je nach den
konkreten Bedingungen in diesem oder jenem Betrieb ist es
möglich, durch energischen Widerstand Zugeständnisse zu
erkämpfen, die den Beginn der Lohnarbeitslosigkeit durch
Abfindungen „versüßen“ oder neue individuelle Lebensperspektiven
eröffnen. Solange es aber dabei bleibt, haben diese Kämpfe einen
mehr als Faden Bei- und Nachgeschmack, weil sie ohne jede
gesellschaftliche Perspektive bleiben. Sie haben absolut nichts
zu tun mit einer Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, sie dienen
ausschließlich der Linderung ihrer Auswirkung auf die einzelnen
LohnarbeiterInnen. Solange Lohnabhängige ihre
Lohnarbeitslosigkeit als individuelles Schicksal erleben,
solange Belegschaft „ihre“ Pleite als bloße betriebliche Pleite
erleben, gibt es keine soziale Perspektive.
An dieser
Situation kann sich überhaupt nur etwas ändern, wenn es den
Betroffenen gelingt, sich von der Vorstellung frei zu machen,
ihr Schicksal sei das Produkt von „Missmanagement“. Erst wenn
die Erkenntnis sich breit macht, dass Unternehmenszusammenbrüche
und Lohnarbeitslosigkeit systematisch erzeugt werden, die
Besonderheiten des „eigenen“ Betriebes nebensächlich sind,
können die Auseinandersetzungen von einem anderen Ausgangspunkt
her und mit einer realistischen sozialen Perspektive geführt
werden. Realistisch wird die Sache nämlich erst dann, wenn man
anfängt, über das angeblich Unmögliche, andere
Produktionsverhältnisse nachzudenken.
Lohnarbeit
ist nicht die Lösung, sondern die Ursache des Problems, der
Kampf um jeden Lohnarbeitsplatz von daher ein Schmarn. Soweit es
für die Restbestände radikaler Kapitalismuskritik im Kontext
solcher betrieblicher Kämpfe, mit denen wir es in Zukunft noch
reichlich zu tun haben werden – ob man sie toll findet oder
nicht -, etwas sinnvolles zu tun gäbe, bestünde das in einer
ganz bestimmten Aufklärungsarbeit. Darunter verstehe ich nicht
die konzentrierte Absonderung allgemeiner Phrasen über das
Kapital, sondern die hartnäckige Lieferung und zusammenhängende
Darstellung von Fakten, Zahlen, die deutlich machen, dass
Unternehmenszusammenbrüche, Lohnarbeitslosigkeit etc. keine
isolierten Phänomene sind, die Individuen und einzelne Betriebe
betreffen, sondern dass es sich um massenhafte,
gesellschaftliche Phänomene handelt, die mit dem sozialen Status
von Lohnabhängigkeit zusammenhängen. (Beispielhaft sind solche
Argumentationen, und „Materialzusammenstellungen“, wie sie
Rainer Roth immer wieder liefert, etwa in „Nebensache Mensch“.)
Elementares Klassenbewusstsein drückt sich überhaupt erst in der
Erkenntnis dieser Zusammenhänge aus und ein solches elementares
Klassenbewusstsein wäre die Voraussetzung für die nötige
Offenheit, um über andere Produktionsverhältnisse nachzudenken
und zu diskutieren. (Es würde den Rahmen dieses Artikels
sprengen, wollte ich an dieser Stelle die Frage nach den
möglichen und notwendigen Formen von Vergesellschaftung,
insbesondere die Frage der Verstaatlichung diskutieren.) Ein
solches elementares Klassenbewusstsein ist aber weit vorher
schon die Voraussetzung für Verbreiterung der Bewegung und sich
entwickelnde Organisierung der Klasse. Diese Verbreiterung der
Bewegung und ihre Organisierung wären sowieso das wichtigste
Resultat der einzelnen Kämpfe. Das allein würde eine praktische
Perspektive eröffnen! Ohne ein Minimum an Klarheit über die
Gesetzmäßigkeit, mit der das Kapital soziale Polarisierung und
Verelendung erzeugt, kann es jedoch überhaupt kein
Klassenbewusstsein geben und bleibt damit jede Verbreiterung und
Organisierung der Bewegung eine Illusion!
Der ethische
Wert der Solidarität bleibt hilfloser moralischer Appell,
solange er nicht verankert ist in der Erkenntnis der
verbindenden Lebensumstände der Lohnabhängigen und der daraus
erwachsenden gemeinsamen Interessen. Die vorherrschende
Gewerkschaftspolitik verhindert bzw. erschwert die Entwicklung
des angesprochenen elementaren Klassenbewusstseins, indem sie in
ihrer Agitation beispielsweise jede einzelne Pleite nicht als
Teil der „Pleitenflut“ darstellt und einordnet, damit jede
systematische Kritik am Kapital ausschließt, und stattdessen in
ihrer gesamten Öffentlichkeitsarbeit die „Einzigartigkeit“
dieser Pleite unterstellt, die ausschließlich das Produkt einer
unfähigen Geschäftsführung sei. So bleibt vorerst sicher
gestellt, dass das Kapitalverhältnis selbst als Produzent der
Massenarbeitslosigkeit ungeschoren davon kommt.
Editorische Anmerkungen
Der Artikel
wurde Mitte April 2007 verfasst und uns zur Veröffentlichung
in der Mainummer überlassen.