|
Betrachtet man den für alle Pflegeverträge mit Wirkung vom
Juli 2008 verbindlichen Rahmenvertrag „Vertrag über ambulante
pflegerische Versorgung“, der von der
Bundesarbeitsgemeinschaft Hauskrankenpflege e. V. vorgegeben
wird, kommt man sehr schnell zu dem Schluss, dass der pflege-
und hilfebedürftige Mensch kaum über Rechte gegenüber dem
Pflegedienst verfügt (Vertragstext siehe Anhang). Er hat nach
Abschnitt 6 nur ein einziges Recht – das Recht auf
Vertragskündigung. Das Wort „Recht“ kommt ansonsten in dem
Text nicht vor. Dafür werden etliche Pflichten dem
pflegebedürftigen Menschen auferlegt. Dreimal kommt dort das
Wort „Wunsch“ vor.Der pflegebedürftige Mensch darf nach
Abschnitt 1.3 „Wünsche“ äußern, wie er gepflegt und versorgt
werden möchte. Ob ihm diese „Wünsche“ gewährt werden, hängt
von der Gnade des Pflegedienstes ab. Nach Abschnitt 1. 5
erhält der Pflegebedürftige „auf Wunsch eine Kopie der
Dokumentation gegen Berechnung.“ Nach Abschnitt 8 gibt es die
Möglichkeit einer Vereinbarung über die Rücksichtnahme auf
„besondere Wünsche des Pflegebedürftigen“.
Was die Ausgestaltung der Vertragswirklichkeit anbetrifft, so
sucht man im Rahmenvertrag vergeblich einen Verweis auf § 11
Abschnitt 1 des Pflege-Versicherungsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland (PflegeVG). Diese Rechtsvorschrift
definiert die Grundpflichten des Pflegedienstes:
„Die
Pflegeeinrichtungen pflegen, versorgen und betreuen die
Pflegebedürftigen, die
ihre Leistungen in Anspruch nehmen, entsprechend dem allgemein
anerkannten Stand medizinisch-pflegerischer Erkenntnisse.
Inhalt und Organisation der Leistungen haben eine humane und
aktivierende Pflege unter Achtung der Menschenwürde zu
gewährleisten.“
Doch
statt dieser Grundpflichten des Pflegedienstes zur Einhaltung
von Leistungs- und Menschenrechtsstandards erscheint unter
Abschnitt 1.3 des Rahmenvertrages lediglich das Versprechen,
sich um die Beachtung des Prinzips der kleinsten Betreuerzahl
zu bemühen:
„Der
Pflegedienst bemüht sich im Rahmen seiner Personalausstattung
um eine kontinuierliche Betreuung durch möglichst wenige
Mitarbeiter.“
Fazit: Dieser Rahmenvertrag begründet, gewollt oder
nicht, für den pflegebedürftigen Menschen in der Tendenz
nichts anderes als ein Gnadenrecht, wie es vor der Erklärung
der Rechte des Menschen und des Bürgers von 1789 in weiten
Teilen Europas existierte. Zur Erinnerung sei Artikel 1 dieser
Erklärung hier zitiert:
„Frei und gleich an Rechten werden die Menschen geboren und
bleiben es. Die sozialen Unterschiede können sich nur auf das
gemeine Wohl gründen.“
Mehr
als zweihundert Jahre später, am 20. Januar 2005, legt
erstmalig eine deutsche Regierung, die Regierung der
Bundesrepublik Deutschland, eine Charta der Rechte der hilfe-
und pflegebedürftigen Menschen vor, die im Geiste der
Erklärung der Rechte des Menschen und des Bürgers
unveräußerbare Rechte des pflegebedürftigen Menschen
definiert. Die acht Artikel dieser Charta, die noch etliche
Unterabschnitte beinhalten, lauten:
„Artikel 1: Menschenwürde und Selbstbestimmung
Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch, auch der rechtlich
Betreute, hat das Recht auf Hilfe zur Selbsthilfe sowie auf
Unterstützung, um ein möglichst selbstbestimmtes und
selbständiges Leben führen zu können.“
Artikel 2: Körperliche und seelische Unversehrtheit, Freiheit
und Sicherheit
Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das Recht, vor
Gefahren für Leib und Seele geschützt zu werden.
Artikel 3: Pflege, Betreuung und Behandlung
Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das Recht, dass
ihm die Pflege, Betreuung und Behandlung zukommt, die seinem
Bedarf entspricht und seine Fähigkeiten fördert.
Artikel 4: Privatheit
Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das Recht auf
Wahrung und Schutz seiner Privat- und Intimsphäre.
Artikel 5: Information, Beratung und Schulung
Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das Recht,
umfassend über Möglichkeiten von Hilfe- und Pflegeangeboten
beraten zu werden.
Artikel 6: Kommunikation, persönliche Zuwendung und Teilhabe
an der Gesellschaft
Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das Recht auf
Wertschätzung, Austausch mit anderen Menschen und Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben.
Artikel 7: Religion, Kultur und Weltanschauung
Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das Recht, seiner
Kultur und Weltanschauung entsprechend zu leben und seine
Religion auszuüben.
Artikel 8: Palliative Begleitung, Sterben und Tod
Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das Recht, in
Würde zu sterben.“
Da
jedoch der Rahmenvertrag die Charta der Rechte der hilfe- und
pflegebedürftigen Menschen nicht zu seiner rechtlichen
Voraussetzung hat, weil diese nur als Entwurf existiert,
erwachsen daraus auch keinerlei verbrieften Rechte für den
pflege- und hilfebedürftigen Menschen. So ist er auf Gedeih
und Verderb dem ihn pflegenden Pflegedienst ausgeliefert.
Und doch wird Kritik an der Pflege durch den pflege- und
hilfebedürftigen Menschen, sei es in Form des Widerspruchs,
sei es in Form der Unterbreitung von Verbesserungsvorschlägen,
vom Gesetzgeber gefordert. In § 4 Abschnitt 3 PflegeVG heißt
es:
„Pflegekassen, Pflegeeinrichtungen und Pflegebedürftige haben
darauf hinzuwirken, dass die Leistungen wirksam und
wirtschaftlich erbracht und nur im notwendigen Umfang in
Anspruch genommen werden.“
Doch
unter Voraussetzung, dass die Pflege-Charta eben kein durch
den Bundestag beschlossenes Gesetz darstellt, muss diese
Rechtsvorschrift für den pflegebedürftigen Menschen
bedeutungslos bleiben. Beruft er sich dennoch auf sie, d. h.
trägt er selbstbewusst Pflegekritik zur Verteidigung seiner
Rechte als Mensch und Bürger gegenüber dem Pflegedienst vor,
riskiert er die Kündigung des Pflegevertrages. Pflegedienste
entledigen sich allzu unbequemer kritischer Vertragspartner
mittels des erlaubten Rechtsmittels der Vertragskündigung, die
unanfechtbar ist und nicht begründet werden muss. So gesellt
sich zur gesundheitsbedingten Abhängigkeit des
pflegebedürftigen Menschen auch noch die Angst, in
existentielle Gefährdungen gestoßen zu werden, und er
unterlässt die Pflegekritik. Einen speziellen
Kündigungsschutz, wie ihn beispielsweise Wohnungsmieter durch
das Mieterschutzgesetz der Bundesrepublik Deutschland
gegenüber den Haus- und Wohnungseigentümern haben, gibt es für
den pflegebedürftigen Menschen nicht.
In der Tendenz wird so der wegen seines Alters zum pflege- und
hilfebedürftigen Menschen gewordene souveräne Bürger im
letzten Teil seines Lebens seiner Rechte auf Freiheit und
Teilhabe an der Gesellschaft beraubt. Er fällt über weite
Strecken in die vorbürgerliche Feudalgesellschaft zurück. Frei
und gleich an Rechten wurde dieser Mensch geboren und bleibt
es – trotz 1789 – am Ende nicht.
Helfen könnte ihm nur die Umwandlung des Entwurfes der Charta
der Rechte der hilfe- und pflegebedürftigen Menschen in ein
bindendes Gesetz.
Anhang
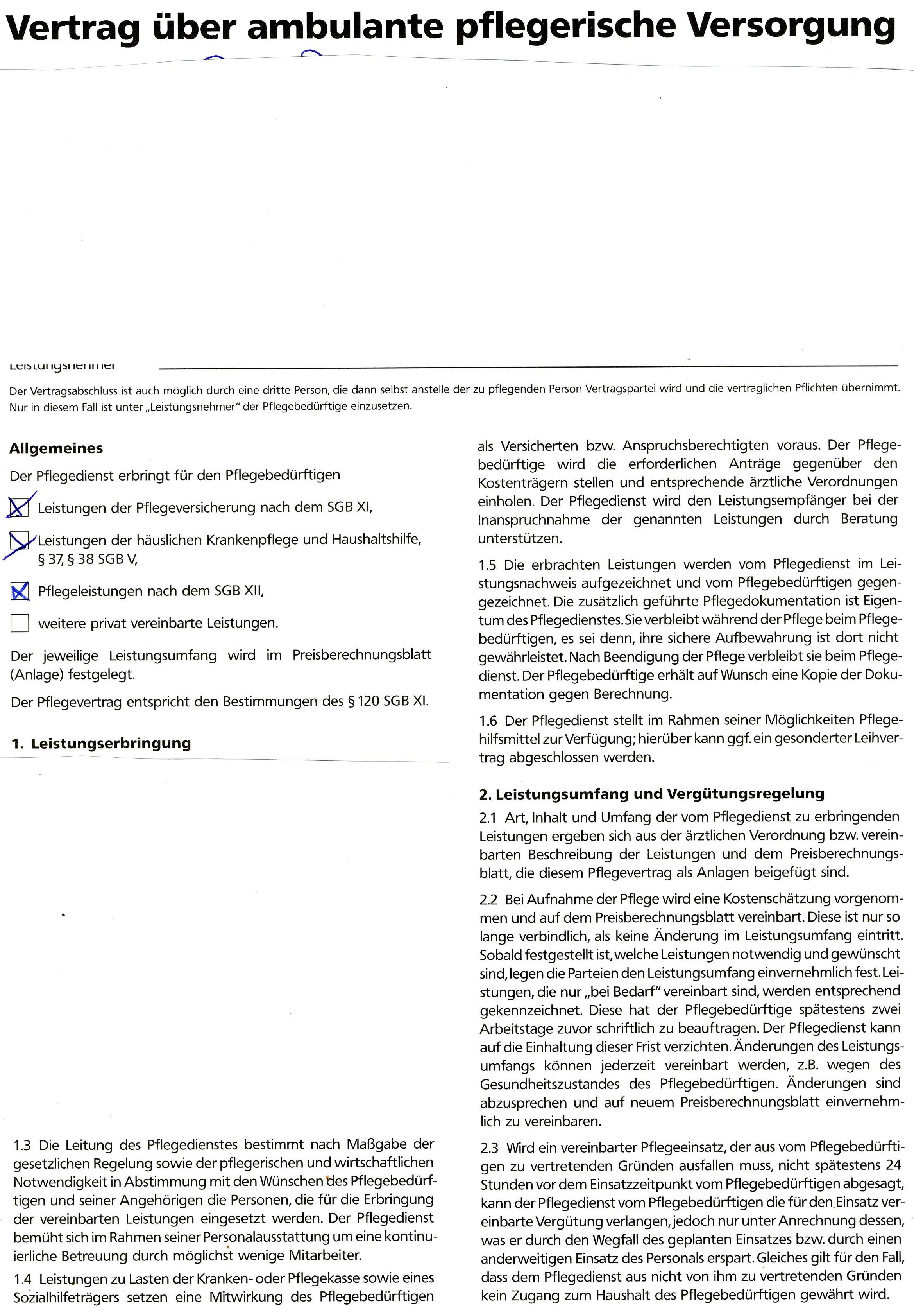
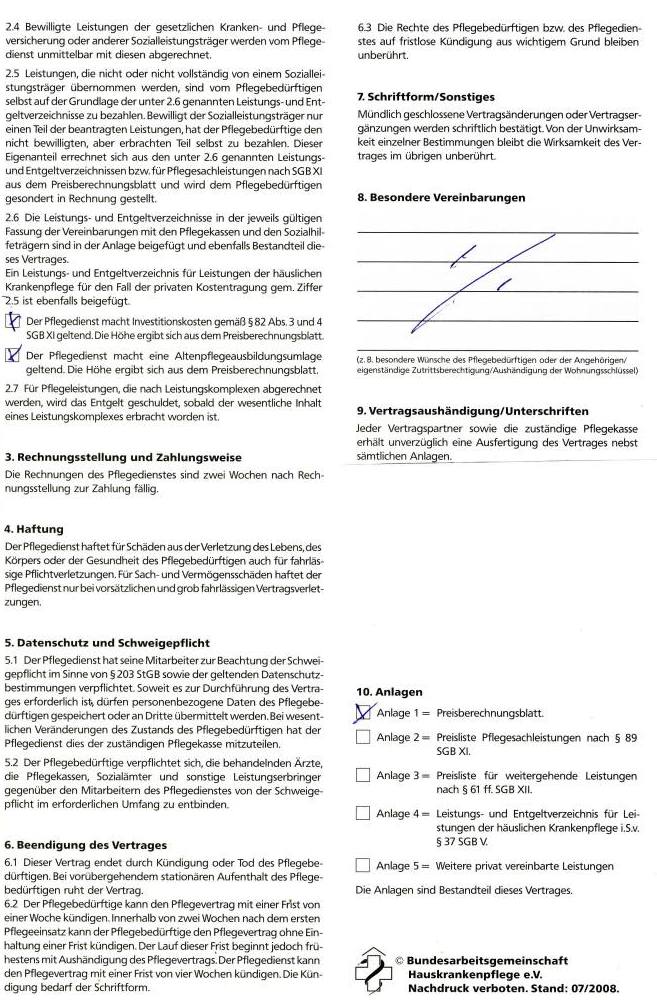
Editorische Anmerkung
Wir erhielten den Artikel vom Autor für diese
Ausgabe.
|